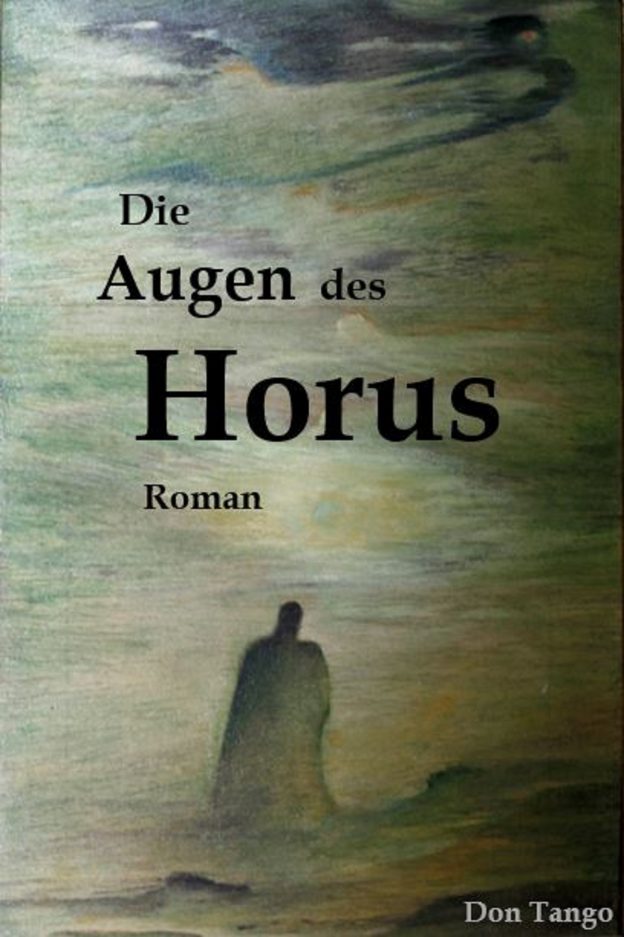Montagvormittag – Peleponnes, Kalamata, Mantineia, die wilden Dörfer auf dem Halbinsel-Finger und Leonidas, mit seinem Höllenloch haben meine Fässer reichlich vollgemacht. Besonders der kriegerische König, mit seinem Stolz und unbändigem Freiheitswillen. Es fing damit an, dass ich von Sonntag.- auf Montagnacht ziemlich schräg geträumt hatte. Natürlich ging es ums Kämpfen, Nichtaufgeben und Durchhalten und so. Ich war ziemlich beeindruckt, wie locker ich da mitmachen konnte. Wenn man die richtige Technik drauf hat, den Schwung der schweren Klinge nutzt und den Schild mit der Linken stramm am Körper hält, kann man ziemlich lange kämpfen. Testosteron, Freiheit oder Tod. Für kämpferische Männer ist das Leben im Grunde einfach. Freund, oder Feind. That’s all folks, anything else?
Irgendwann rappelte ich mich auf. Auch Krieger brauchen eine Tasse starken Kaffee um wach zu werden. Ich war immer noch heiser von der ewigen Rumbrüllerei. Im Nahkampf ist es wichtig, dass man die gegnerische Motivation und all ihren Enthusiasmus möglichst im Keim erstickt. Brüllen macht laut Leonidas über zwanzig Prozent des Sieges aus, besonders wenn der König ständig vorauseilt und aus Leibeskräften schreit und seine Soldaten mitreißt.
Heute funktioniert das auf dem Schlechtfeld nicht mehr. Nicht nur, dass die modernen Könige ganz locker vom Wohnzimmer aus Twittern und nur hin und wieder in ihrem Büro ein langweiliges Stück Papier unterzeichnen, sie haben heutzutage noch dazu so viele Verantwortliche in ihrem Staat, dass für sie selbst kaum Arbeit und Verantwortung übrig bleibt.
Und Helden gibt es längst nicht mehr, eher das Gegenteil. Auch im modernen Nahkampf ist heute alles anders. Aus meiner Sicht verdient er nicht mal mehr den Namen, denn man kommt kaum dichter als zehn Meter an den Gegner ran. Irgendeiner wird als erster abdrücken und ein Loch in einen Wanst ballern. Vielleicht hat man Glück und man schleppt dich ins Lazarett, wo sie dir das Loch wieder zunähen, wie bei einer ollen Socke.
Aber früher, da musstest du dem Perser, Angesicht zu Angesicht, irgendetwas abhacken. Man konnte das nicht in der Gruppe diskutieren, weil der arme Perser ne böse Kindheit hatte. Als Spartiate nahm man sich Recht, ihm den Hals abzuschlagen, oder seinen Bauch aufzuschlitzen. Umgekehrt galt das natürlich auch.
Na jedenfalls, sind Leonidas und ich uns einig geworden, zusammen ein Buch über seinen Nachfolger zu schreiben, der sein Königreich Sparta weniger laut und kriegerisch zu führen versucht. Schauen wir mal, ob uns das gelingt – und vor Allem, ob Griechen so ein Buch heutzutage spannend finden.
Dies alles und noch mehr, schwirrte mir am Montagmorgen im Kopf herum, weswegen ich beschloss, nichts zu machen, außer den Horizont zu beobachten, ob er sich eventuell von alleine erweiterte. Weißwein war hier die perfekt Begleitung zur Overtüre, bevor es ans Eingemachte, und somit zu Rosé und später zu Rotwein überging. Nachdem die Dunkelheit schon ein paar Stunden fertig vor sich hindämmerte, kroch ich in mein Bett, rollte mich ein und segelte davon.
Dienstag – im Yurt schlafe ich gut und lange. Über eine Stunde döste ich vor mich hin, bevor ich mich um halb elf aus dem Bett schälte und zum Frühstück ging, dass selbst in Kleinstform noch so reichlich blieb, dass ich den ganzen Tag davon hatte. Mein Kopf blieb immer noch mit viel Zeugs beschäftigt. Ich entschloss mich zu schreiben, um Platz für Neues zu schaffen. Den ganzen Tag lief es plätschernd vor sich hin. Seite um Seite füllte sich wie von alleine. Für den Abend hatte ich eine Dinner-Einladung von Freunden erhalten, die sich in Kopanaki aufhielten.
Gemütlich mäanderte der Tag vor sich hin. Ich machte zwei kleine Pausen, sonst nichts außer Schreiben. Das Dinner war für halb zehn angesetzt. Um sieben packte ich meine Schreibutensilien ein, duschte ausgiebig, fuhr mein Motorrad tanken und knatterte Richtung Kalamata. Von da ging es weiter. Eine Stunde später sitze ich bei Zipouro und Speisekarte in einem kleinen Dorf, westlich von Kopanaki. Drei griechische Ladies, zum Bersten gefüllt mit Energie und Temperament, zeigen mir schnell, wer heute die Unterhaltungen anführt.
Auch sonst, geht es ziemlich schnell zur Sache. Wir lassen kaum ein Thema aus und bestellen zwischendurch Wein, Wasser und Futter. Als der Kellner das dritte Mal Platten abstellt, frage ich mich, wer das alles essen soll. Hätten sie die Hälfte gemacht, wäre es immer noch zu viel – aber so? Alles schmeckt ganz köstlich, keine Frage, aber diese Berge sollten wir uns einpacken lassen. Irgendwann nach Mitternacht machen wir genau das: Einpacken, zahlen und vom Fresskoma erschlagen nachhause rollen. Für mich heißt das, noch mal eine Stunde auf meinen Blechgaul springen und in die Berge von Kalamata reiten. Gegen drei liege ich im Bett, alle Reservoirs sind übergelaufen, inklusive Magen. Schnell gleite ich hinweg in einen traumlosen Schlaf.
Mittwoch – Mein letzter Tag auf dem Peleponnes. Es wird Zeit, dass ich Kalamata besichtige. Nach einem etwas kompakten Frühstück sattle ich den Gaul und reite Richtung Großstadt. Ich fahre ein wenig im alten Stadtzentrum herum, sehe mir den Hafen an und stelle zwanzig Minuten später den Zweizylinder ab. Stramme 35 Grad wabern um mich herum. Geschwind steige ich aus meinen Mopedklamotten und entere die Altstadt in sommerlichen Shorts & T-Shirt.
Mein Ziel, die kleine Apostelkirche im Herzen der Stadt. Hier begann die griechische Revolution am 23.März 1821. Und wenn man vor dieser kleinen Kirche steht, passiert etwas. Sie ist klein, grau, uralt und völlig frei von Prunk – genau das macht sie für mich, zu einer beeindruckenden Kirche. Sicherlich es gibt gewaltigere, riesenhafte, glamouröse und markerschütternd mächtige Kirchengebäude – aber genau das, ihre Bescheidenheit, ihre geringe Größe, machen sie viel einladender, viel stärker und gleichzeitig wärmer, als alle anderen.
Größe, Grandiosität, Ruhm, Glorie und Glanz – Konservierungsstoffe der Vergangenheit. Futter für Egoismus und menschliche Eitelkeit. Schon immer stießen mich diese Dinge ab. Schreitet man zur Tat, bricht man auf zu neuen Ufern, hilft einem Konformismus und Treue zum Status Quo nicht – im Gegenteil, dann muss man bereit sein, Risiken einzugehen und alles aufs Spiel zu setzen. Dann kann eine kleine Kirche, zum Mittelpunkt der Erde werden.
Schon immer waren es Träumer und Utopisten, die unsere Welt aus den Angeln heben – nicht die braven und automatischen militärisch-handelnden Knastschließer, Gesetzesvertreter, Richter, Gauleiter, Blockwarte, Meister.- und Ehrenbürger, die wie kleine, täglich-aufgezogene Spielzeuguhren die existierende Maschine am Laufen halten, mag der Gang eben dieser eher einem Stolpern und Taumeln ähneln, um wie reifes Fallobst vom Baum der Geschichte zu fallen, um endlich Neuem zu weichen. Ich fühlte mich in der Nähe der alten Kirche sehr wohl. Ganz Kalamata hat eine angenehme Ausstrahlung.
Der alte Bahnhof, im Zentrum der Stadt ist zum Museum umfunktioniert worden. Man ließ die alten Dampflokomotiven einfach stehen. Ein abschließender Besuch am Hafen, mit köstlichen Gyros ließ mich schnell zur Meinung kommen, hier könnte man wunderbar leben. Mit reichlich Wein und gemeinsamem Abendessen mit der Eigentümerfamilie, wurde mein letzter Abend niedergesungen. Zufrieden darüber, ein erstes Gefühl für die Griechen und ihr Land bekommen zu haben, schlief ich glücklich ein.
Donnerstag – wach werden, frühstücken, Sachen packen, Moped tanken und aufbrechen, Richtung Athen, Hauptstadt aller Griechen. Mollige Temperaturen begleiteten mich bei meiner Fahrt, um die Gebeine der Peleponnes-Berge herum. Große Namen rauschten an mir vorbei. Tripoli, Olympia, Nafplio, Argos, Mykene, Nemea – ein Donnerwetter von geschichtlichen Größen, abgerundet, durch den Kanal von Korinth, der so tief ist, dass ich beim Hineinsehen fast vergessen hätte der Autobahn zu folgen. Mein Gott ist das ein Crazy-Bauwerk! Eine Tank und Beinpause ließ mir etwas Zeit, mich auf Athen vorzubereiten. Ehrlich gesagt gibt es zu Piräus, dem Industriehafen und Erdöl.- / Benzinumschlagplatz wenig zu sagen, außer, dass er groß und ziemlich nüchtern gehalten ist, was meiner Vorfreude auf Athen in keiner Weise beeinträchtigen sollte.
Stetig näherte ich mich der großen alten Dame an. Nachdem ich um ein paar Bergnasen herumfuhr, lag sie plötzlich da. Einfach so, inmitten ihrer permanenten Wehen, ihrem ganz normalen Sommerfieber. Und mittendrin, stolz, alles überragend, die Akropolis, mit dem weltberühmten Pantheon und all den anderen monumentalen Bauten.
Plötzlich, wie aus dem Nichts, verwandelte sich die Autobahn in eine Stadtrennbahn, die stetig breiter und breiter wurde. Fahrzeuge wuselten wild umher. Menschen rannten über Straßen. Schwärme von Scootern, Mopeds und Mofas rieselten durch die vor den Ampeln wartenden Autos hindurch. Außer mir war niemand mit Helm unterwegs, geschweige Handschuhe und Sicherheitsklamotten, dafür aber mit Sonnenbrillen, Flipflops und Shorts bewaffnet. Eine Stadt im Dauerfieber.
Keine Ahnung, wie oft ich anhielt, um mich zu orientieren. Keinen blassen Schimmer, wie oft ich mich verfuhr, oder mich im Kreis drehte, völlig verwirrt, von dem Gewusel, den Straßenführungen, die es vermutlich nur so ähnlich in Asiatischen Großstädten wie z.Bsp.Hanoi gibt. Ich kam mir vor, wie in einem Brummkreisel, oder einem Hurrikan. Entweder rettest du dich, indem du ganz schnell rausrennst, oder fährst und dich am äußersten Rand festklammerst, um ja nicht wieder hineingezogen zu werden – oder du springst direkt rein ins Auge des Sturms, hinein ins unbekannte Abenteuer. Dreimal dürft ihr raten, genau – Letzteres.
5 Millionen wahnsinnige Zigeuner auf knatternden Zwiebacksägen, die klingen, als könnten sie Roggenbrot schneiden. Und dann dazu die Wärme! Wenn man sich der Stadt nähert, ist das, wie wenn man stückweise in ein heißes Bad aus flüssiger Energie und Licht getunkt wird. Langsam aber sicher köchelst du im eigenen Saft, ohne zu wissen, wohin dich das führt und was mit dir geschieht. Geräusche, Gerüche, Bilder, Filme – dein ganzer Körper fängt an vor Reizüberflutung zu summen.
Ich hatte ein Zimmer bei einer Lady gebucht. Im Inserat sprach sie davon, dass es still ist, obwohl man direkt zu den Füßen der Akropolis wohnt. Ich war gespannt. Doch erst einmal musste ich das gelobte Land finden. Ein Wust von glatten Einbahnstraßen, mit und ohne Löcher ließen mich irgendwann Lächeln und durstig werden. Nach jeder Biegung hielt ich, um mich zu vergewissern, wo ich wirklich war. Mein Smartphone war längst genauso besoffen wie ich. Und ständig brettern dir diese Mopeds um die Ohren!
Irgendwann schien ich mich in das richtige Nadelöhr eingefädelt zu haben. Und dann ging alles ganz schnell. Plötzlich stand ich vor meiner neuen Unterkunft. Stilvoll, ein schönes Jugendstil-Stadthaus, mit Olivenbäumen davor. Nur eine Klingel. Wie einfach. Ich drückte die Glocke. Jemand öffnet, Filia steht vor mir. Vielleicht Ende Fünfzig, sehr geschmackvoll angezogen. Sie bittet mich rein. Wow, was für ein schöner Innenhof. Überall ranken sich Weine und stehen Oliven herum. Ein Kleinod, mitten im Stadtzentrum und von außen überhaupt nicht ersichtlich, einfach toll.
Wir verstehen uns sofort. Mein Zimmer ist wunderschön. Sogar mit eigenem Bad und WC ausgestattet – die Götter meinen es gut mit mir. Ich ziehe mich um, bekomme ein paar Zipouro’s als Willkommens-Schnaps gereicht und taumle leicht angetüdelt ins wuselige Leben. Noch nie habe ich so viele Gaukler, Künstler, Händler, Ganoven und Verzweifelte auf einem Haufen gesehen.
Jeder wirft sich dem anderen zum Fraß vor. Touristen werden grundsätzlich von allen gefressen. Es ist eher ein Fleddern. Schön ist, dass es schnell geht, dass der Geschundene es nicht merkt. Er lächelt dabei glücklich in schwarz-glänzende Zigeuner-Augen und ist stolz von solch glühenden Kohlen, mit so einer Vergangenheit bestohlen zu werden, vor der sich die ganze Welt verneigen muss.
Irgendwann finde ich ein Restaurant, das noch nicht zu sehr touristisch pervertiert ist und angemessene Preise, für gutes Essen bereithält. Mein Erster Kalamar auf grichische Art – ein Wahnsinn, dazu ein rot-eloxiertes Halbliter-Töpfchen Weißwein, dazu Wasser – fertig ist der gelungene erste Athener Abend. Völlig überwältigt und müde wie ein Zyklop stolpere ich zurück in mein schönes kleines Stadtparadies, wo ein Bett auf mich wartet.
Die knatternden Mopeds vom offenen Fenster höre ich irgendwann genauso wenig, wie die anschlagenden Alarmanlagen, von heißgesessenen Autos, denen die Hitze mehr zusetzt, als Menschen. Reifen geht die Luft aus – Lack verliert jeglichen Gganz nach kurzer Zeit, ganz ähnlich wie mir, der sich fast auf allen Vieren ins Bett rettet, eine letzte Rettungsboje setzt und in einen bleiernen Schlaf hinweggleitet.
Freitag – erster voller Tag im Griechen-Mekka. Mit Wanderschuhen bewehrt stapfe ich nach einem kleinen Frühstück in einem benachbarten Café los. Erstmal beim Hadriantor vorbeischauen. Wow! Typisch Römer. Direkt dahinter das Olypieum, auf dem großen Gelände eines Zeus-Heiligtums. Wie riesig der gewesen sein muss. Seine bestehenden Säulen sind über 10 Meter hoch. Wirkt besonders beeindruckend, wenn man die Akropolis im Hintergrund sieht.
Die Stadt ist voll von Geschichte. Unter jedem bisschen Sand kann ein weiteres Wunder liegen. Beeindruckend ist auch die Sonne, die mir mit ca 40 Grad auf den Helm glüht. Zum Glück habe ich Wasser dabei und wandere weiter Richtung Olympiastadium, genauer gesagt, zu jenem Platz, wo die ersten Spiele der Neuzeit stattfanden. Als ich davor stehe stockt mir der Atem.
Es ist riesig, geformt wie die alten Stadien der Leichtatheleten von früher, also 30m breit und über 200 lang – so konnten die Zuschauer näher am Geschehen sein. Heute ist das natürlich alles aus Sicherheitsgründen verboten, weswegen man dies Schmuckstück nicht mehr für den Sport, sondern für Konzerte nutzt – was ein Jammer.
Es ist ganz aus Marmor gemacht, weswegen man es Kali-Marmoro nennt – also „Schöner Marmor“ – und das ist es wahrhaftig. Jetzt weiß ich auch, wo Albwert Speer das Design für sein Deutsches Stadion in Nürnberg klaute, oder sagen wir mal höflicherweise, angelehnt hat. Bestimmt 2h sitze ich als alter Leichtathlet darin und wandere ein bisschen umher und atme die alten Sportgeschichten ein, die hier geschrieben wurden. Irgendwann laufe ich langsam zurück und nehme einen kleinen griechischen Salat zu mir, dazu Weißwein.
Anschließend nehme ich mir eine Auszeit – Siesta-Time. Hitze, Sonne, Lauferei und Eindrücke plätten mich. Ich schlafe über 2h. Nachdem ich mich neu formatiert habe. Geht es gegen 20 Uhr wieder raus in die wilde Stadt. Ich stapfe durch die Touristen-Massen. Rosen werden mir angeboten; ich lehne ab, die Junge Lady will mir eine schenken, will wissen, wo ich herkomme – ich bedanke mich noch einmal und gehe weiter. Alte Frauen betteln hier und da. Kleine Mädchen, höchstens 8-12 Jahre spielen mit Harmonicas, mit Hüten davor.
Finde das ziemlich krass, muss ich sagen. Man muss hier höllisch aufpassen, in den richtigen Laden zu gehen. Wenn du falsch wählst, zahlst du den doppelten Preis, bei schlechter Qualität. Für viele Touristen ist es jedoch gut genug, weswegen sie mit hochroten Köpfen unter ihren Ventilator-Gekühlten Sonnenschirmen sitzen und sich ihre Bierkrüge an den durstigen Hals hängen.
Ich werde fündig. Kein Touriladen, dafür viele Einheimische, noch dazu tolles Essen und gute Weine. Hier gehe ich bestimmt wieder hin. Ich bestelle gegrillte Sardinen und Lamm. Glückselig knuspere ich mich in die Nacht, schenke kräftig nach, wie es sich für echte Griechen gehört und schlurfe weit nach Mitternacht zufrieden in meine schöne Oase. Leise lösche ich das Licht und schlummere hinfort.
Samstag – zweiter Tag unter den Augen von Göttin Athena. Wieder Frühstück im Café nebenan. Omelett und griechischer Kaffee und los geht’s westlich der Akropolis. Wieder Tempel, Musen-Monumente, Römische Stoa, Tempel des Hephaistos, Gott der Handwerker, Schmiede und Künstler. Schön erhalten. Siehtaus wie das Parthenon, nur kleiner. Ein antiker Marktplatz, Agora genannt. Alte Kirchen. Hadrians Bücherei, die von der Fläche so groß ist, wie ein großer Lidl-Supermarkt. Ein Turm der Winde – aber am wichtigsten für mich, das Gefängnis meines Freundes Sokrates!
Man hat es in den Berg geschlagen. Hier hat er der Dinge geharrt, bis er stolz und mit Würde das Urteil anerkannte und den Schierlingsbecher trank. Wohin man auch sieht: Die Großen und Bahnbrechenden fristen zu Lebzeiten immer ein karges und hartes Dasein. Zu blind und arrogant ist das Establishment – blind und Machtversessen – hört das denn nie auf? Ich mache Fotos, bis mein Smartphone ausgeht. Der Blick über Athen ist atemberaubend. Diese Mischung aus uralter Kultur, vermischt mit modernen urbanen Leben ist berauschend.
Hoffen wir mal, dass die Rechten hier nicht zu lange an der Macht bleiben, die man erst vor wenigen Wochen wählte – ausgerechnet hier, wo man die Demokratie erfunden hat. Ich verstehe die Menschen nicht mehr, denke ich mir und kehre in einer Taverna ein. Hier wähle ich mein erstes falsches Gericht – Chefsalat. Darf man nie machen. Man muss immer den griechischen Standardsalat nehmen, weil der überall gleichgut gemacht wird. Nunja, gehört dazu.
Nach 5h umherwandern falle ich mit vollem Magen ins Bett – Siesta-Time. Ich schlafe 3h und komme erst um 21:00 hoch. Filia hat eine Freundin zu Besuch. Die zwei laden mich ein dazuzukommen. Es wird ein netter Abend, da die Freundin Übersetzerin für Literatur ist. Schnell kommen wir beim leckeren Dinner ins Gespräch. Wir reden zu dritt über Götter und die Welt. Beide wollen mir helfen, meine Bücher ins Griechische zu übersetzen, was sagt man dazu?
Gegen 1:00 machen wir einen Spaziergang Richtung Akropolis. Wir diskutieren weiter. Sie erklären mir, dass man jetzt mehr Polizei sieht. Die Konservativen und Rechten wollen immer mehr Sicherheit schaffen – nur für wen? Und wer fragt danach? Schrittweise legt man so Städte trocken. In Toulouse sind sie auch dabei. Und jetzt sogar Athen. Irgendwie macht mich das ein wenig niedergeschlagen, wenn sogar die Griechen unter dem gleichen Scheiß leiden – zum Kotzen! Mit grimmigen Gedanken bin ich um drei Uhr im Bett und schlafe sofort ein.
Sonntag – heute ist Waschtag und Hausarbeit angesagt, auch weil ich mein Frühstück sehr spät einnehme und es erst gegen halb vier, mit einem Glas Wein versteht sich, beendet habe. Wenn man nur mit Rucksack reist, so wie ich, muss man einmal die Woche seine Klamotten waschen. Bei Filia kann ich alles mitbenutzen, wie z.Bsp. ihre Waschmaschine. Auch muss ich eine Unterkunft für Kreta buchen und meine französische Steuererklärung für 2018 abgeben. Und natürlich, dass ist das Allerwichtigste, muss ich schreiben.
Während die zwei Maschinen laufen mache ich mich ans Werk und tippe wie verrückt drauflos. Zu viel ist in meinem Kopf. Zu viel, dass endlich raus muss. Gegen zwanzig Uhr mache ich eine Pause und gehe Essen. Ich finde eine kleine Taverna, die hauptsächlich griechische Gäste hat. Allerding merke ich, dass die Saison sich dem Ende naht. Alle Kellner und Servicekräfte sind müde und haben selten die Muße, einem Kerl zu helfen, der ihre Sprache lernen will – schade. Ein paar machen mit, aber man sieht ihnen die Müdigkeit an.
Ich habe gefüllte Paprikas, ein Klassiker, dazu Retzina – was will man mehr? Gegen zehn mache ich mich auf den Heimweg, um diesen Text fertigzumachen. Ich gehe zum Kühlschrank, schenke mir ein kleines Glas ein und lade den Text hoch. Es ist vollbracht – Prost!